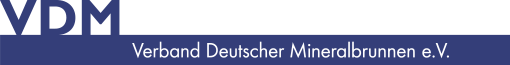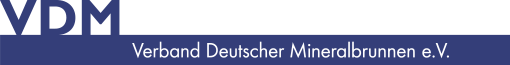|
Begrüßung und Moderation |
| 13:00 Uhr |
Karsten Schwanke,
Moderator und ARD-Meteorologe
|
|
|
|
Grußwort
Catrin Schiffer,
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
|
|
Teil I |
| 13:05 Uhr |
Stand und Perspektiven der Regulierung der Wasserqualität
|
|
|
|
Der Green Deal – mehr als Klimaziele
Jutta Paulus,
MdEP, Die Grünen/EFA
|
|
|
|
Zur Verantwortung für Spurenstoffe – von den ethischen Grundlagen zur Herstellerverantwortung im Wasserrecht
Dr. Jörg Wagner,
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)
|
|
|
|
Was fehlt bisher, was brauchen wir Neues? Ein biologisch-ökologischer Blick auf die Umweltrisikobewertung von Spurenstoffen
Prof. Dr. Rita Triebskorn,
Institut für Evolution und Ökologie, Universität Tübingen
|
|
Teil II: |
| 13:50 Uhr |
Relevante Aspekte für Wasserqualität
|
|
|
|
Pestizidmischungen auf dem Acker – Diskrepanz zwischen Risikobewertung und Realität
Prof. Dr. Andreas Schäffer,
Institut für Umweltforschung, RWTH Aachen
|
|
|
|
Spurenstoffe und Gewässerschutz
Dr. Thomas Kullick,
Verband der Chemischen Industrie (VCI)
Dr. Günter Müller,
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
|
|
|
|
Rahmenbedingungen der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln
Dr. Achim Gathmann,
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
|
|
|
|
Einfluss des Klimawandels auf Wasserdargebot und Abwasserbehandlung
Dr. Friedrich Hetzel,
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA)
|
|
|
|
Wasserqualität und Klimawandel: Was macht die Schweiz?
Dr. Michael Schärer,
Bundesamt für Umwelt (BAFU)/CH
|
|
|
| 15:00 Uhr |
Paneldiskussion
Dr. Achim Gathmann,
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
|
|
|
|
Dr. Thomas Kullick,
Verband der Chemischen Industrie (VCI)
|
|
|
|
Prof. Dr. Martin G. Grambow,
Vorsitzender Bund/ Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)
|
|
|
|
Ingrid Schmittnägel,
Institut ROMEIS
|